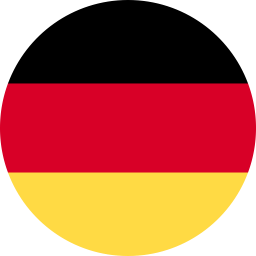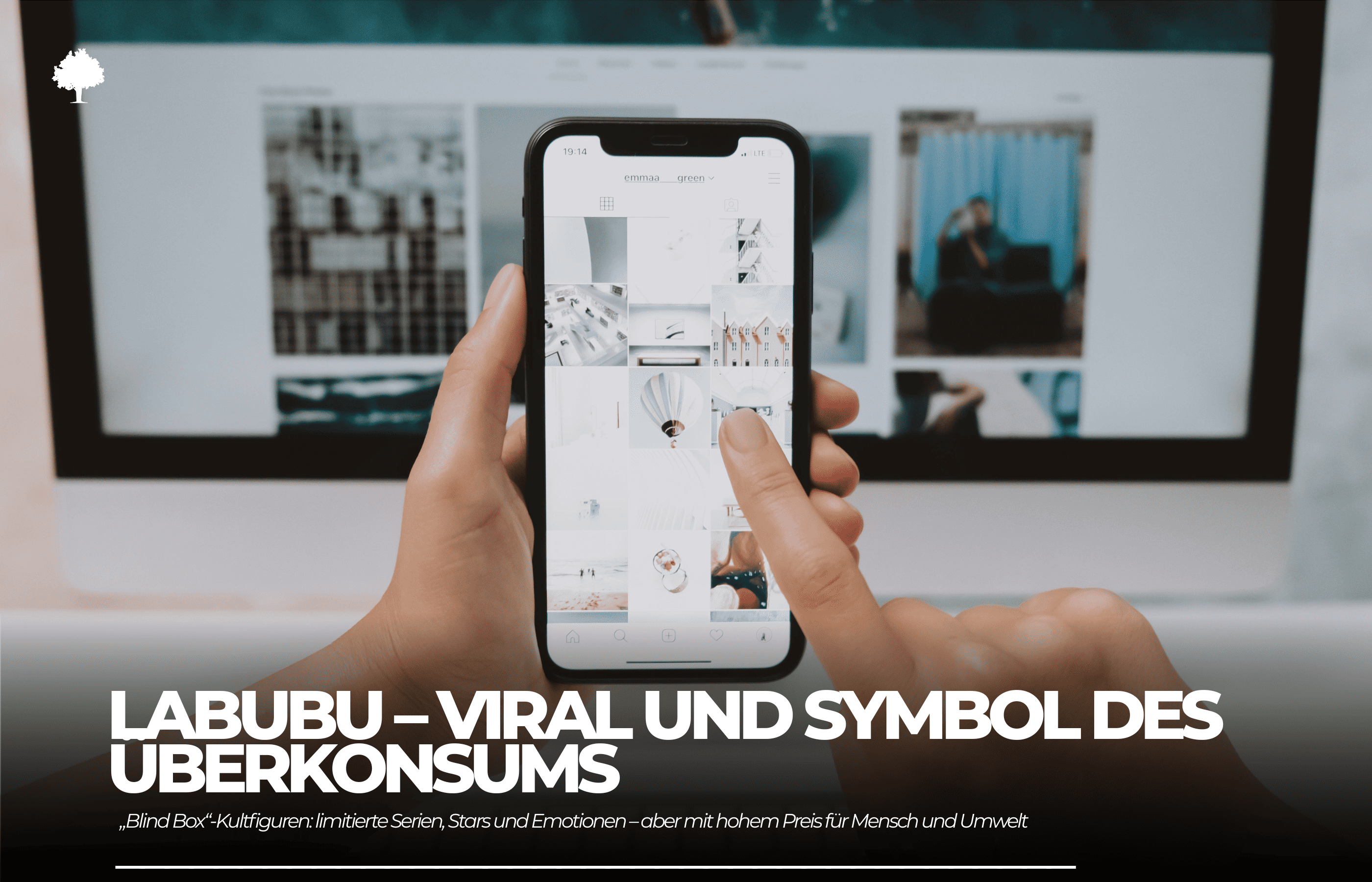
In den letzten Jahren hat sich unsere Art des Kaufens und Konsumierens grundlegend verändert. Ein besonders prägnantes Beispiel für diesen Wandel ist der Labubu-Trend. Die kleinen, farbenfrohen Figuren im „Blind Box“-Format haben TikTok, Instagram und die Herzen von Sammlern weltweit im Sturm erobert.
Dieser Artikel versucht, das Phänomen besser zu verstehen. Wir gehen der Frage nach, warum wir uns so leicht von Konsum mitreißen lassen, welche psychologischen Mechanismen den viralen Hype antreiben und wieso wir so empfänglich für gesellschaftlichen Druck sind. Zudem betrachten wir die Psychologie hinter Kaufentscheidungen, den FOMO-Effekt, die Folgen exzessiven Sammelns sowie Alternativen, die uns helfen können, bewusster zu konsumieren.
Inhaltsverzeichnis
1. Einleitung
2. Das Labubu-Phänomen und der virale Hype
3. Der Mechanismus der „Blind Boxen“ und die Psychologie von FOMO
4. Überkonsum in der Praxis: was nach dem Kauf geschieht
5. Gesellschaftliche Auswirkungen von Kaufzwang
6. Alternativen: bewusster Konsum und nachhaltige Gadgets
7. Fazit
8. FAQ
Das Labubu-Phänomen und der virale Hype
Die kleinen, charmanten Labubu-Figuren sind zu einem der auffälligsten Symbole der heutigen Konsumgesellschaft avanciert. Sie stammen vom Hongkonger Künstler Kasing Lung und werden von POP MART produziert. Ihre Beliebtheit reicht weit über das klassische Kinderspielzeug hinaus – sie gelten inzwischen als trendiges „Must-have“ und Lifestyle-Accessoire, angetrieben von sozialen Medien und viraler Vermarktung.
Wie soziale Netzwerke Kauftrends beeinflussen
Plattformen wie TikTok, Instagram und YouTube sind die Haupttreiber des Labubu-Hypes. Nicht klassische Werbung, sondern die Funktionsweise der Algorithmen bestimmt, was angesagt ist.
-
Unboxing-Clips von „Blind Boxen“ mit Labubu-Figuren erzielen Millionen Klicks.
-
Hashtags wie #Labubu, #POPmart oder #BlindBox boomen weltweit.
-
Influencer zeigen ihre Sammlungen und verstärken so den sozialen Druck, die neuesten Editionen haben zu müssen.
Wir kaufen nicht mehr das, was wir tatsächlich benötigen – wir kaufen das, was gerade Trend ist. Soziale Medien verstärken das Gefühl: Ohne Labubu gehörst du nicht dazu.
Labubu als Statussymbol
Die Faszination der Labubu-Figuren beruht darauf, dass ihr Wert in erster Linie emotional und nicht praktisch ist. Sie erfüllen keine Funktion, sind aber zum Statussymbol und Ausdruck der Zugehörigkeit zu einer Subkultur geworden.
Sammler jagen den seltensten Modellen nach, und limitierte Editionen bieten die Möglichkeit, sich online wie offline abzuheben. POP MART steuert dies gezielt durch verknappte Auflagen, was ihre Attraktivität erhöht und ein Gefühl von Exklusivität erzeugt. Jeder neue Release gleicht einem Wettlauf – nur die Schnellsten haben die Chance, zuzuschlagen.
Wie TikTok, Instagram und Influencer den Hype antreiben
Vor allem die sozialen Netzwerke haben Labubu zu einem globalen Trend gemacht:
-
TikTok – kurze, dynamische Videos vom Öffnen der „Blind Boxen“ wirken wie ein visuelles Glücksspiel. Die Spannung besteht darin, ob eine seltene Figur erscheint.
-
Instagram – Sammler inszenieren ihre Figuren in kunstvollen Galerien und machen Labubu zu einem festen Bestandteil ihres Lifestyle.
-
Influencer – viele erhalten die neuesten Kollektionen exklusiv vorab und erzeugen damit den Eindruck, man müsse sofort dabei sein, um nicht außen vor zu bleiben.
Auffällig ist, dass der Hype weitgehend von den Nutzern selbst getragen wird – sie erstellen Inhalte, die das Interesse ständig weiter anfachen. Schon wenige virale Clips reichen aus, damit neue Serien binnen Minuten ausverkauft sind.
Der Mechanismus der „Blind Boxen“ und die Psychologie hinter FOMO
Die enorme Popularität der Labubu-Figuren beruht im Wesentlichen auf dem Verkaufsprinzip der „Blind Boxen“. Es handelt sich dabei nicht bloß um einen Marketingkniff – sondern um einen gezielt entwickelten psychologischen Mechanismus, der unser Belohnungssystem stimuliert, Dopamin ausschüttet und sozialen Druck erzeugt.
Was verbirgt sich hinter „Blind Boxen“ und weshalb faszinieren sie uns?
„Blind Boxen“ sind kleine Verpackungen, die jeweils eine Figur aus einer Serie enthalten. Der Käufer weiß vorher nicht, welches Modell sich darin befindet – die gesamte Erfahrung lebt von der Überraschung. Bei Labubu bestehen die von POP MART herausgebrachten Kollektionen in der Regel aus mehreren Varianten:
-
Standardfiguren – in großer Stückzahl verfügbar,
-
Limitierte Editionen – wesentlich seltener und schwer zu ergattern,
-
„Chase Figures“ – extrem seltene Sammlerstücke, die besonders begehrt sind.
Das Prinzip gleicht einem Glücksspiel: Man zahlt nicht nur für die Figur, sondern auch für den Nervenkitzel des Enthüllens. Jedes Öffnen bringt Spannung und Vorfreude. Gerade diese Ungewissheit verleitet dazu, erneut zuzugreifen – und den nächsten Box zu kaufen.
Dopamin – der Motor hinter dem Kaufrausch
Die Faszination für Blind Boxen lässt sich neurologisch erklären: Unser Belohnungssystem reagiert auf spannende Reize mit der Ausschüttung von Dopamin – einem Neurotransmitter, der Freude, Motivation und Antrieb erzeugt.
Im Fall von Labubu verläuft dieser Prozess typischerweise so:
-
Vorfreude – schon beim Kauf steigt die Erwartung, da die Chance besteht, eine seltene Figur zu ziehen.
-
Enthüllung – im Augenblick des Öffnens setzt ein starker Dopamin-Kick ein.
-
Freude oder Ernüchterung – ist eine exklusive Figur dabei, ist die Begeisterung riesig; wenn nicht, entsteht oft sofort der Wunsch, es erneut zu versuchen, um den „Fehlschlag“ auszugleichen.
Diese Mischung aus Unsicherheit und Belohnung aktiviert dieselben Mechanismen wie beim Glücksspiel. POP MART nutzt dieses Wissen gezielt und begrenzt bewusst bestimmte Modelle, um den Eindruck von Einzigartigkeit und Wettbewerb noch zu verstärken.
FOMO – sozialer Druck und das Gefühl „man darf nicht fehlen“
Das sogenannte FOMO (Fear of Missing Out, also die „Angst, etwas zu verpassen“) ist einer der zentralen Antreiber für den Kauf von Labubu-Figuren. Die sozialen Medien verstärken diesen Effekt massiv:
-
Auf TikTok und Instagram tauchen Videos von Sammlern auf, die die neuesten Kollektionen ergattert haben.
-
In Fan-Communities präsentieren immer mehr Menschen stolz ihre Neuzugänge.
-
So entsteht der Druck, ebenfalls mitzumachen – sonst könnte man etwas Wichtiges verpassen.
Besonders stark wirkt FOMO, wenn limitierte Editionen erscheinen. Das Wissen, dass eine Figur möglicherweise bald endgültig aus dem Verkauf verschwindet, lässt die Kaufbereitschaft sprunghaft ansteigen.
Überkonsum im Alltag: Was nach dem Kauf passiert
Wir kaufen, packen aus, sind begeistert … und dann landet die Figur im Regal. Was zunächst als Quelle der Freude erscheint, wird oft schnell zu einem weiteren Staubfänger. Das Labubu-Phänomen zeigt exemplarisch das Problem des Überkonsums – immer mehr Dinge anzuschaffen, die wir nicht wirklich benötigen, nur weil sie für einen kurzen Moment Glücksgefühle auslösen.
Zugestellte Wohnungen, wachsendes Chaos und „Staubsammlungen“
Die Labubu-Figuren sind klein, doch eines haben sie gemeinsam: Ihre Zahl nimmt ständig zu. Für viele beginnt mit ein oder zwei Figuren eine Sammelspirale:
-
Es werden immer neue Serien gekauft, weil man die fehlenden Modelle ergänzen möchte.
-
Neue Editionen werden bestellt, bevor die vorherigen überhaupt ausgepackt sind.
Die Konsequenz: Wohnräume verstellen sich zunehmend. Figuren verlieren ihren besonderen Stellenwert und werden Teil einer Anhäufung, die nur noch … Staub ansammelt. Ein Paradox des modernen Sammelns: Die Jagd nach Neuheiten führt oft zu Unordnung statt zu Zufriedenheit.
Das Paradox der Zufriedenheit: Warum Kaufen uns nicht glücklicher macht
Die Konsumpsychologie zeigt, dass die Freude am Erwerb nur von kurzer Dauer ist. Der Ablauf lässt sich so beschreiben:
-
Vor dem Kauf – allein die Aussicht, etwas Besonderes zu erhalten, erzeugt Euphorie.
-
Beim Kauf – ein plötzlicher Glücksschub durch den Dopamin-Ausstoß.
-
Nach dem Kauf – die Wirkung lässt rasch nach, die Emotionen flauen ab.
-
Kurz darauf – wir machen uns auf die Suche nach der nächsten „Belohnung“.
Das „hedonische Hamsterrad“ — die ständige Suche nach Neuem
Dieses Phänomen, von Psychologen als hedonisches Hamsterrad (hedonic treadmill) bezeichnet, erklärt den Mechanismus des Überkonsums. Er verläuft nach folgendem Muster:
-
Mit jedem neuen Besitz erleben wir ein kurzes Hochgefühl.
-
Schon bald gewöhnt sich das Gehirn daran und die Freude lässt nach.
-
Um die gleiche Aufregung wiederzuerlangen, brauchen wir etwas Neues.
-
Dieser Kreislauf setzt sich endlos fort.
Gesellschaftliche Auswirkungen von Kaufzwang
Das Labubu-Phänomen ist mehr als nur ein kurzer Hype – es verdeutlicht tiefgreifende Veränderungen unserer Konsumkultur. Einerseits treiben psychologische Effekte wie die Jagd nach Dopamin uns zu immer häufigeren Käufen. Andererseits haben die großen Produktionsmengen und die kurze Lebensdauer der Produkte gravierende Konsequenzen für Umwelt und Lebensweise.
Wie die Sofort-Belohnungs-Kultur unsere Gewohnheiten prägt
Der heutige Konsument bewegt sich in einer Welt ständiger, unmittelbarer Befriedigung. Soziale Netzwerke, Werbung und die Algorithmen von Online-Shops überfluten uns mit Reizen, die einen Impuls auslösen sollen: „jetzt kaufen“.
Dieses Muster beschränkt sich nicht auf Figuren. Es findet sich ebenso in anderen Lebensbereichen: Fast Fashion, Elektronik, Kosmetik, Mobile Games … Wir leben in einer Kultur, die auf „mehr“ und „schneller“ setzt, wobei unsere Kaufentscheidungen immer seltener aus realen Bedürfnissen heraus entstehen.
Umweltauswirkungen: Mikroplastik, Abfall und CO₂
Mit jeder Labubu-Figur holen wir uns auch ein Stück Umweltproblem ins Haus. Eine einzelne Figur wirkt unbedenklich, doch im großen Maßstab sind die Folgen enorm:
1. Mikroplastik und Abfall
-
Labubu-Figuren von POP MART bestehen größtenteils aus Vinyl und anderen Kunststoffen.
-
Die Produktion dieser Materialien erzeugt Abfälle, die schwer zu entsorgen sind.
-
Gelangen die Figuren auf Deponien, zersetzen sie sich langsam und setzen Mikroplastik in Boden und Gewässer frei.
2. Verpackungsflut durch „Blind Boxen“
Das Konzept der „Blind Boxen“ verschärft das Abfallproblem zusätzlich:
-
Jede Figur steckt in einer Kartonverpackung, die noch einmal durch eine innere Kunststoffhülle geschützt ist.
-
Wer mehrere oder sogar ein Dutzend Boxen kauft, produziert große Mengen Einwegabfall – meist ohne Recyclingmöglichkeit.
3. CO₂-Belastung
-
Die Produktion der Labubu-Figuren erfolgt vor allem in Asien, von wo sie weltweit verschickt werden.
-
Der Transport per Luft- und Seefracht verursacht erhebliche CO₂-Emissionen.
-
Die steigende Nachfrage nach immer neuen Serien treibt eine ressourcenintensive Produktion an, die zusätzliche Energie und Rohstoffe verbraucht.
Alternativen: Bewusster Konsum und nachhaltige Gadgets
Sobald man versteht, wie der Mechanismus des Überkonsums wirkt, stellt sich die Frage, wie sich die Kaufspirale durchbrechen lässt. Wachsende Sensibilität für Umweltthemen und das Streben nach Minimalismus führen dazu, dass immer mehr Menschen nach Alternativen suchen – Produkte, die langlebig, nützlich und ressourcenschonend sind.
Strategien gegen den Kaufrausch
Statt die Freude am Einkaufen komplett aufzugeben, kann man lernen, klüger einzukaufen. Einige Ansätze dafür:
-
Erstelle eine Einkaufsliste – frage dich vorab, ob du den Artikel wirklich brauchst oder ob es nur ein spontaner Wunsch ist.
-
Lass Zeit verstreichen – wenn dich etwas anspricht, warte 24–48 Stunden. Oft verfliegt das Kaufbedürfnis von selbst.
-
Lege ein Budget für Extras fest – erlaube dir kleine Freuden, aber im Rahmen klarer Grenzen.
-
Wertschätze deine Sammlung – bevor du eine weitere Figur kaufst, schau, was du bereits besitzt. Ist es wirklich ein Muss, oder nur der Druck des Trends?
-
Setze auf Qualität statt Masse – langlebige, praktische und nachhaltige Produkte bringen langfristig mehr Freude.
Dieser Ansatz hilft nicht nur dabei, die eigenen Ausgaben besser zu kontrollieren, sondern trägt auch dazu bei, Unordnung zu verringern und unseren ökologischen Fußabdruck zu reduzieren.
Minimalismus und „Less Waste“ als wachsende Trends
Immer mehr Menschen erkennen, dass weniger Besitz auch mehr Lebensqualität bedeuten kann. Minimalismus heißt nicht, vollkommen auf Dinge zu verzichten, sondern bewusst diejenigen zu wählen, die echten Wert haben.
-
Minimalismus ermutigt dazu, sich mit haltbaren, funktionalen und ästhetisch ansprechenden Produkten zu umgeben.
-
Less Waste setzt auf die Verringerung von Abfällen durch die Wahl von Mehrwegartikeln oder recycelbaren Materialien.
-
So kaufen wir insgesamt weniger, aber hochwertiger – Produkte, die uns über Jahre hinweg dienen, anstatt schnell zum Staubfänger zu werden.
Naturkork – ein Paradebeispiel für Nachhaltigkeit
Ein herausragendes Beispiel für nachhaltige Rohstoffe ist Naturkork. Dieses nachwachsende Material stammt aus der Rinde der Korkeiche und bietet großes Potenzial in der Herstellung umweltfreundlicher Produkte.
Warum gilt Naturkork als umweltfreundlich?
-
Die Rinde wird geerntet, ohne den Baum zu fällen – er bleibt gesund und kann sich regenerieren.
-
Die Herstellung verursacht kaum Abfall und hinterlässt nahezu keinen CO₂-Ausstoß.
-
Naturkork ist biologisch abbaubar und zu 100 % recycelbar.
Beispiele für Naturkork-Gadgets
-
Fitness- und Yogamatten – rutschfest, strapazierfähig und von Natur aus feuchtigkeitsbeständig.
-
Globen und Dekorationen – leicht, dekorativ und designstark.
-
Thermobecher und elegante Untersetzer – vereinen Nützlichkeit mit Ästhetik.
-
Kugelschreiber – angenehm im Griff und natürlich im Design.
-
Portemonnaies, Etuis, Taschen und Rucksäcke – federleicht, robust und wasserresistent.
-
Regenschirme – eine umweltfreundliche Alternative.
-
Sandalen und Schuhe – dämpfend, komfortabel und atmungsaktiv.
-
Schreibtisch-Organizer – stilvolle Ordnungslösungen für den Arbeitsplatz.
-
Bilderrahmen – schlicht, natürlich und langlebig.
-
Computermaus – ergonomisch geformt, leicht und mit angenehmer Haptik.
Fazit
Das Phänomen der Labubu-Figuren verdeutlicht eindrucksvoll, wie soziale Medien, das Blind-Box-Prinzip und der FOMO-Effekt unsere Kaufentscheidungen beeinflussen. Die Spannung beim Auspacken, die Jagd nach limitierten Modellen und der soziale Druck, mitzuhalten, reißen uns mit. Doch die anfängliche Freude vergeht rasch, während ständige Neuanschaffungen zu überfüllten Regalen, Unordnung und Unzufriedenheit führen.
Eine mögliche Antwort auf dieses Problem ist bewusster Konsum – die Entscheidung für langlebige, alltagstaugliche und umweltfreundliche Produkte. Besonders anschaulich sind Accessoires aus Naturkork, die Design, Funktionalität und Nachhaltigkeit verbinden. Statt eine weitere Figur zu kaufen, die rasch an Bedeutung verliert, können wir Dinge wählen, die uns über Jahre hinweg begleiten und gleichzeitig das Prinzip „Less Waste“ unterstützen.
FAQ – Häufig gestellte Fragen
1. Woran merke ich, dass ich in eine Überkonsum-Spirale geraten bin?
Kaufst du Figuren oder andere Produkte spontan, nur um festzustellen, dass sie ungenutzt im Regal verstauben, ist das ein deutliches Signal. Achte auf deine Gefühle: Wenn Einkäufe eine Reaktion auf Langeweile, Gruppenzwang oder Stress sind, ist es Zeit, innezuhalten.
2. Was kann ich mit Figuren machen, die ich nicht mehr behalten möchte?
Statt sie zu entsorgen, gibt es verschiedene Möglichkeiten:
-
Verkauf über spezielle Plattformen für Sammler,
-
Tausch in Communitys oder Fangruppen,
-
Verschenke sie an jemanden, der sich darüber freut.
So reduzierst du Abfall und ermöglichst den Gegenständen ein zweites Leben.
3. Wie kann ich Käufe aus FOMO vermeiden?
-
Nutze die „24-48-Stunden-Regel“ – warte, bevor du etwas kaufst.
-
Deaktiviere Benachrichtigungen über Neuheiten und Rabatte, wenn sie Druck erzeugen.
-
Mach dir bewusst: Was heute gehypt wird, kann morgen schon vergessen sein.
4. Warum ist es sinnvoll, Produkte aus Naturkork zu wählen?
Naturkork ist ein natürlicher, regenerierbarer Rohstoff mit breitem Einsatzspektrum. Ob Fitnessmatten, Untersetzer, Geldbörsen, Bilderrahmen, Organizer, Trinkbecher oder Computermäuse – diese Produkte sind robust, funktional und langlebig. Damit trägst du aktiv zur Abfallvermeidung bei und unterstützt die „Less Waste“-Bewegung.